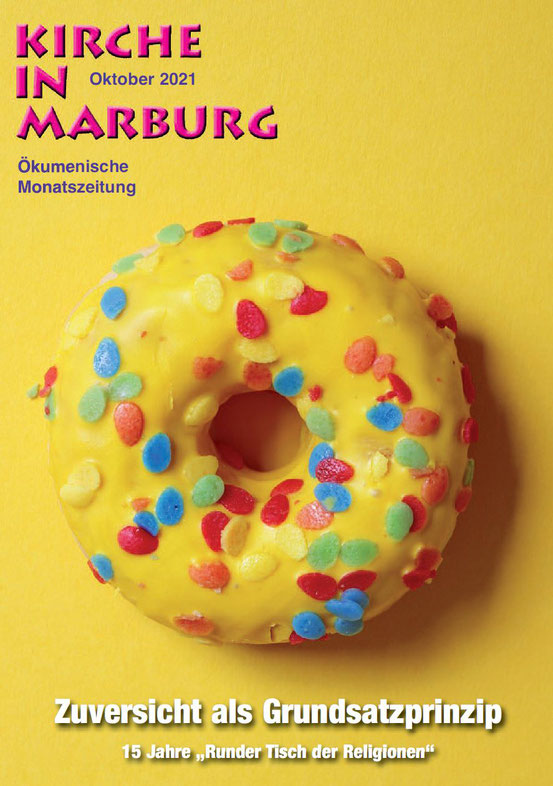Zuversicht als Grundsatzprinzip
15 Jahre „Runder Tisch der Religionen“

Im Jahr 2006 gründete sich in Marburg der „Runde Tisch der Religionen“ – das Interesse war groß, die Skepsis nicht klein. Angehörige verschiedener Religionen wollten sich zusammensetzen, sich austauschen, miteinander reden, einander verstehen lernen. Welche Bilanz ziehen die Beteiligten nach 15 Jahren? Welche Relevanz messen sie der Institution selbst bei? Wo sehen sie die Bedeutung des Runden Tisches in der Zukunft?
„Es geht darum, Räume zu öffnen“, sagt Joachim Simon, Pfarrer an der Marburger Universitätskirche. Und damit sind längst nicht nur die Räume gemeint, in denen die Angehörigen der verschiedenen Religionen beten. Auch die Räume im Kopf. Die Räume im Glauben, im Denken. Und sämtliche Teilnehmer des Runden Tisches nicken. Sie sind für ein Interview zusammengekommen und das nicht an einem Tisch, sondern über eine Video-Konferenz. Corona hat die Möglichkeiten des Dialogs auch für sie limitiert. Kontakt gehalten haben sie dennoch. Sich ausgetauscht. Die nächsten Veranstaltungen geplant. Im August haben ein Friedensforum zum Antikriegstag und ein Diskussionsabend stattgefunden, für den 2. Oktober ist der „Friedensweg der Religionen“ vorgesehen.
Religiöses Interesse an- und Authentizität miteinander
Vor 15 Jahren war der „Runde Tisch der Religionen“ im Anschluss an die internationalen Rudolf-Otto-Symposien der Marburger Philipps-Universität gegründet worden. Pfarrer Dietrich Hannes Eibach, der Marburg inzwischen verlassen hat, und Professor Dr. Hans-Martin Barth waren die Initiatoren. „Es gab ein großes religiöses Interesse aneinander“, sagt Barth, der bis heute am Runden Tisch teilnimmt. „Oft bin ich sehr bewegt von unseren Sitzungen nach Hause gegangen – das ist für mich eine Bibelstunde der höheren Art.“ Neben den evangelischen Christen aus der Universitätskirche sind auch Angehörige der Islamischen und der Jüdischen Gemeinde, der Bahá‘í-Religion und des Buddhistischen Shambhala-Zentrums vertreten – eine große Spannbreite mit ordentlich Konfliktpotential.
Genau das hat man am Anfang bewusst zu vermeiden versucht. Die Teilnehmer bestätigen, dass die ersten Zusammenkünfte eine vorsichtige Annäherung waren, auch thematisch. „Es ging und geht darum, einander kennenzulernen – was der andere glaubt, denkt und fühlt“, erläutert Hans-Martin Barth. Begonnen hat alles zum Beispiel mit der Diskussion über Symbole, die allen Religionen gemeinsam sind. Man besuchte sich gegenseitig, in der Moschee, der Synagoge. „Es war wichtig, Ängste ablegen zu können“, sagt Kelly Herndon aus der Bahá’í-Gemeinde. „Und das war nur möglich, weil alle authentisch miteinander waren.“ Sie sieht in ihrem Engagement für den „Runden Tisch“ auch eine Erfüllung ihrer religiösen Pflichten. Die Glaubensrichtung der Bahá’í begreift die ganze Erde und alle Menschen als Einheit. Ein liebevoller Umgang und das Gespräch miteinander ist für Kelly Herndon ein Weg, zu religiösem Frieden in Marburg beizutragen, wie sie sagt. Und die Einrichtung des „Runden Tisches“ sei etwas, worum man sie in anderen Städten beneide.
Begegnungen auf Augenhöhe und „Empowerment“
„Wir sind uns von Anfang an auf Augenhöhe begegnet“, betont Professor Dr. Bilal El-Zayat, Vorsitzender der Islamischen Gemeinde. „Der Dialog war zwischendurch heftig, aber immer ehrlich.“ Je mehr Vertrauen wuchs, desto mehr konnte man auch thematisch in die Tiefe gehen, bestätigen die anderen Teilnehmer. Für Joachim Simon, der seit zwei Jahren am „Runden Tisch“ teilnimmt, war es eine positive Überraschung, dass auch Streit möglich war und ist. Seine Frau Katja, Pfarrerin und Studienleiterin des RPI der EKKW, ist beeindruckt von der Offenheit der Gespräche und sieht eine Aufgabe in der Beziehungs- und Netzwerkarbeit. „Religionen können nicht miteinander reden, nur Menschen können das“, sagt sie. Einander verstehen lernen sei ein zentraler Punkt. Und das nicht nur an einem Tisch, in der Moschee, in der Kirche, in anderen religiösen Räumen, sondern auch darüber hinaus. Bildungs- und Aufklärungsarbeit gehören für sie ebenfalls zu den Aufgaben des „Runden Tisches“.
„Was wir tun, hat auch mit Empowerment zu tun“, ergänzt Monika Bunk von der Jüdischen Gemeinde. „Wir stehen ja auch als Gesprächspartner zur Verfügung und das würde ich als Auftrag für uns definieren.“ Das Selbstverständnis des „Runden Tisches“ ist nach 15 Jahren ein großes Thema für die Beteiligten. Dass es keine Hierarchien gibt, ist laut Burkhard zur Nieden, Dekan des Marburger Kirchenkreises, sowohl „Geschenk und Kompetenz“, als auch eine relative Schwäche. „Wir sind ein anarchistischer Haufen“, erklärt Bilal El-Zayat schmunzelnd. Es gibt keine typisch deutsche Satzung, die Institution ist kein Verein. „Das ist vorteilhaft für die Integration, aber zum Teil können wir dadurch einem politischen Anspruch nicht gerecht werden“, sagt Burkhard zur Nieden. Und man werde zunehmend politischer wahrgenommen. Es kommen Anfragen zu Statements, Bitten um Interviews. Das sehen die Beteiligten durchaus zwiespältig. „Wir könnten noch mehr Strahlkraft haben“, erklärt Bilal El-Zayat, „aber es war nie unser Anspruch, PR zu betreiben.“

Fremde Räume für möglichst viele Menschen öffnen
„Effizienzdruck würde uns nicht gut bekommen“, stellt Hans-Martin Barth fest. Die Arbeit am „Runden Tisch“ habe ganz klar politische Auswirkungen, aber das sollte seiner Ansicht nach nicht das Ziel sein. Der Fokus liegt auf dem Miteinander. Auch wenn es automatisch eine politische Ebene generiere, sei die spirituelle Ebene ausschlaggebend. „Die Arbeit mit Spiritualität stärkt“, bekräftigt Peter Meinig-Buess vom Shambhala-Zentrum. „Und wir können Solidarität untereinander gebrauchen.“ Nach seiner Einschätzung herrsche eine große „Aggressionslosigkeit“ in Marburg. Aber Freundschaft
und Kommunikation zu pflegen, das beginne im Kleinen, bei jedem selbst – „in der Familie, in Freundschaften, in der eigenen Gemeinde“, so Meinig-Buess. Den anderen Menschen und auch die andere Religion zu achten und zu schätzen, das ist für Bilal El-Zayat grundlegend. „Es geht nicht ums Missionieren oder andere vom eigenen Glauben überzeugen zu wollen“, erklärt er. „Die Vielfalt ist bereichernd.“
Joachim Simon resümiert, man sei schon weit gekommen. Die fremden Räume der anderen Gemeinden empfindet er längst nicht mehr als fremd. Er wünscht sich, dass eine Öffnung der Räume künftig auch anderen Menschen mehr angeboten werden kann. Eine „Gotteserfahrung“ könne man als Gläubiger überall machen. Seine Frau Katja antwortet auf die Frage, was sie sich für die Zukunft wünscht, regelmäßige Angebote im Bereich interreligiöser Kultur. „Wenn ich träumen dürfte, würde ich mir mehr interreligiöse Gottesdienste wünschen“, sagt sie. Hans-Martin Barth würde gern mehr junge Leute dafür gewinnen, sich für andere Religionen zu interessieren. Die Frage sei, wie man mit religiös Desinteressierten stärker ins Gespräch kommen könne. Insbesondere in einer Gesellschaft, in der Spiritualität immer mehr an Bedeutung verliere.

Foto: privat
„Wir müssen aufeinander achtgeben“
Bilal El-Zayat bestätigt, dass der Glaube an Gott zunehmend „uncool“ sei für junge Menschen. Und das trifft vor allem die kleineren Religionen. Umso wichtiger ist für ihn der Dialog und das Miteinander. „Wir müssen aufeinander achtgeben und dürfen uns nicht gegenseitig schaden“, betont er. Wenn heute ein Anschlag auf eine Synagoge verübt werde, dann sei es nur eine Frage der Zeit, bis es auch eine Moschee treffe. „Egal, ob man ein Kreuz oder ein Kopftuch verbietet – es wird gegen uns alle gehen“, mahnt El-Zayat. Dass unter Corona und den notwendigen Maßnahmen die gewohnten Abläufe sowohl innerhalb der jeweiligen Glaubensrichtungen und Gemeinden wie auch im Austausch untereinander wegbrachen, hat alle gleichermaßen getroffen. „Wir werden uns wieder zusammensetzen und sehen, wie wir uns helfen können“, konstatiert Hans-Martin Barth. Zuversicht als Grundsatzprinzip.